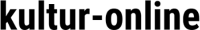Die Sonderausstellung "tuten & blasen" im Vorarlberg Museum betrachtet das Phänomen Blasmusik aus einer ethnologischen Perspektive und rückt die Menschen in den Mittelpunkt.
Wird es festlich in Vorarlberg, rückt die Blasmusik aus. Kaum ein Empfang, ein rundes Jubiläum oder eine größere Feier in den Dörfern und Städten, die nicht von Musikkapellen begleitet werden. Und scheinbar nebenher veranstalten die Vereine noch Konzerte und Musikfeste … Rund 6.000 Musikant:innen in Vorarlberg spielen in 129 Formationen, treffen sich regelmäßig zu Proben, bereiten sich auf Wettbewerbe vor und treten an Wochenenden bei verschiedensten Anlässen auf. Die Ausstellung erzählt von Menschen, die heute die Blasmusik im Land prägen und erkundet erlebnishaft die aktuelle Blasmusikszene. In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Blasmusikverband, der 2024 sein 100-jähriges Jubiläum feiert.
Unzählige Klarinetten, Saxofone oder Trompeten sind von der Decke hängend auf den eintretenden Besucher:in gerichtet, dahinter, auf einen Perlenvorhang projiziert, marschiert kurz und laut eine Blaskapelle auf das Publikum zu. Im Jahreszyklus erklingt Blasmusik bei religiösen oder weltlichen Anlässen. Menschen gestalten seit jeher ihre Lebenswelt mit Klängen. Die Blasmusik gibt gesellschaftlichen Ereignissen eine besondere Bedeutung oder steht bei Konzerten und Festen selbst im Mittelpunkt. Blasmusik ist ein Erlebnis – zumindest für alle jene, die mit ihr etwas anfangen können.
Blasmusikgeschichte(n)
Hinter dem Perlenvorhang: Sockel, in strenger Formation einer Blaskapelle. Fotos und Gegenstände aus dem Besitz Vorarlberger Musikant:innen erzählen von den Menschen in der Blasmusik. Das ist zum Beispiel Helga Pedross, der es als Kind in den 1960er Jahren nicht erlaubt war, in die Männerdomäne Blasmusik einzudringen. Mit 50 lernte sie Tuba und wird darauf in die Stadtmusik Bludenz aufgenommen. Heute ist die Blasmusik mehrheitlich weiblich, zumindest unter den Mitgliedern bis 30 Jahre. Murat Üstün leiht dem Museum seinen Taktstock, mit dem er in den 1990er Jahren die "Hatler Musig" in Dornbirn dirigierte. Bei den ersten Proben blieben einige Stühle leer – doch die Musikanten kamen zurück …
Neben diesen anekdotischen Zugängen, bei denen auch Kritiker der Blasmusik nicht fehlen dürfen, wartet die Ausstellung mit allerlei Wissenswertem über die Geschichte der Blasmusik auf. Auf einem großen Tisch sind verschiedene Dokumente, alle verfügbaren Festschriften der Musikvereine und Karteikarten einsehbar. Hier erfährt man, dass die Vorläufer der Blasmusik bei fahrenden oder bei Hofe angestellten Spielleuten im Mittelalter vermutet werden. Das städtische Pendant dazu waren "Ratsmusiken", die der Repräsentation und Unterhaltung dienten – im Bodenseeraum seit dem 15. Jahrhundert nachgewiesen. Musik war auch ein Symbol für Macht und Wohlstand.
Im 19. Jahrhundert emanzipierte sich das Bürgertum. Bläser schlossen sich zu Gruppen zusammen ("Harmoniemusik"). Die Vereinsbezeichnungen "Bürgermusik" und "Musikverein" verweisen darauf, dass Musik nun für alle zugänglich ist. Vorarlbergs "älteste" Kapelle ist übrigens der Musikverein Hörbranz, der auf die im Jahr 1779 gegründete Feldmusik Hörbranz zurückgehen soll – ein Beispiel für die enge Verbindung zwischen Schützenwesen und Blasmusik. Bis 1850 haben etwa 20 Kapellen in Vorarlberg bestanden. Zwischen 1850 und 1900 gab es mehr als 40 Vereinsgründungen. Wesentlicher Impulsgeber für die Amateurkapellen war die Militärmusik.
Am 23. März 1924 wurde in Dornbirn der Vorarlberger Harmoniebund (heute: Vorarlberger Blasmusikverband) gegründet. Oberstes Ziel war die Förderung und Pflege der Blasmusik. Nach der Auflösung durch die Nationalsozialisten wurde der Verein 1948 reaktiviert. Sieben Jahre später gehörten ihm bereits 100 Vereine an. Die Militäruniformen wichen nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr den Trachten, ein Beispiel für den Einflussbereich des Verbandes. Heute sind die Musikkapellen die größte Gruppe der Trachtenträger:innen in Vorarlberg.
Wo die Musi‘ spielt …
Wie sehr sich das Repertoire in den letzten 100 Jahren verändert hat, ist in der Ausstellung anhand einer Musikcollage in einem zylinderförmigen Raum erlebbar – in voller Lautstärke, ein körperliches Erlebnis! Er markiert den Übergang zu den vielen Orten, an denen die Blasmusik anzutreffen ist: der Proberaum, die Straße, Konzerte und Wettbewerbe sowie das gemütliche Beisammensein nach den Auftritten. Sarah Mistura hat diese Orte im Sommer 2023 mit ihrer Kamera dokumentiert. Entstanden ist das Panorama einer vielfältigen, lebendigen, generationenübergreifenden Szene, die für viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ein wichtiger Teil ihrer Freizeit einnimmt. In kurzen Videos erzählen Menschen von ihren Tätigkeiten, die meist nicht im Mittelpunkt stehen, die für Vereine aber zentral sind: Jugendreferent:innen, Marketender:innen, Fähnrich:innen, Notenwart:innen, Instrumentenwart:innen, Bekleidungswart:innen, Archivar:innen …
Im inszenierten Proberaum haben die Besuchenden die Möglichkeit, eine Kapelle zu dirigieren – zumindest lassen sich über ein Mischpult die einzelnen Stimmen einer Kapelle steuern. Wie Proberäume geplant werden und wie die Probe einer Blasmusikkapelle abläuft, demonstrieren Videos.
Ausrücken, marsch!
Die wichtigste Aufgabe der Blasmusik ist der öffentliche Auftritt, das Ausrücken auf die Straßen der Gemeinden oder Städte. Der jeweilige Anlass erhält durch den Klang eine festliche Bedeutung für die Gemeinschaft. Klänge unterstützen und verstärken freudige oder traurige Momente, Musik hilft, Emotionen Ausdruck zu verleihen.
Inszenierte Versatzstücke deuten in der Schau eine Straße an. Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentieren eine Vielzahl von Anlässen, bei denen Blasmusik dabei war: das Begräbnis des ehemaligen Vizekanzlers Jodok Fink 1929 in Andelsbuch, der Empfang für Olympiasieger Toni Innauer 1980 oder die Freigabe der Walgauautobahn im Jahr 1981.
Letzte Station – Festzelt
Der Rundgang entlang der Orte der Blasmusik endet in einem mit Textilien angedeuteten Festzelt. Wenn der Auftritt vorbei ist, Fest oder Wettbewerb gut über die Bühne gegangen sind, beginnt ein nicht unwesentlicher Teil des Vereinslebens – das gemütliche Zusammensein bei Bier oder Wein. Zitate auf Bierbänken und Tischen lassen Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse aufleben. In Videointerviews erzählen Musikant:innen über ihre Motivation, in einer Kapelle mitzuwirken. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist ein wesentlicher Grund. Der Begriff "Klangkörper" kommt nicht von ungefähr. Und Engelbert Beck vom Musikverein Lingenau berichtet über den immensen Aufwand, ein Blasmusikfest zu organisieren.
"tuten & blasen" - Blasmusik in Vorarlberg
Bis Frühjahr 2025