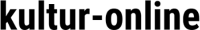Abermals begeisternd ist die Wiederaufnahme der Neuinszenierung von Claus Guth an der Wiener Staatsoper, und wieder Asmik Grigorian als Turandot, alle weiteren ebenso hervorragend, wie auch die musikalische Leitung von Axel Kober.
"Eis, das dich entflammt, und von deiner Flamme noch eisiger wird! Weiß und dunkel! Will es dich frei, macht es dich umso mehr zum Knecht! Nimmt es dich als Knecht an, macht es dich zum König. Also, Fremder! Die Angst lässt dich erblassen! Und du fühlst dich verloren! Los, Fremder: Das Eis, das entflammt, was ist das?" Das dritte Rätsel der Prinzessin, die bisher kaltblütig alle Freier köpfen ließ, kann der Unbekannte lösen. "Jetzt hat mein Sieg dich mir geschenkt! Mein Feuer lässt dein Eis schmelzen: Turandot!"
Der Regisseur Claus Guth erzählt nicht ein Märchen im klischeehaften, fernöstlich ausgestatteten Ambiente, sondern er bleibt klar, reduziert und zeichnet ein nachvollziehbares Psychogramm eines verstörten, verletzten Menschen: "Ich möchte zeigen, mit welch gewaltigem Aufwand sich Turandot davor schützt, erneut zum Opfer zu werden. Dadurch gerät sie in die Rolle des Täters." Wir erfahren von ihrer Ahnin ("In questa reggia"), der vor Tausenden Jahren großes Leid angetan wurde. Asmik Grigorian ist darstellerisch so präsent – mit langem weißem Haar, weiß gekleidet, als Requisit nur das Bett – und lässt das Drama mit ihrem exzellenten Gesang heftig berührend nachempfinden.
Calaf hat zwar alle richtigen Antworten gegeben, wird jedoch Turandot nicht gegen ihren Willen zur Frau nehmen. Er legt sein Schicksal wiederum in ihre Hand. Der aus Nordsibirien stammende Ivan Gyngazov ist ein höhensicherer, wunderbarer Tenor und wenn endlich sein „nessun dorma“ ertönt, will der Applaus gar nicht mehr enden. Die ganze Stadt versucht also fieberhaft seinen Namen herauszufinden, und nur eine könnte diesen wissen. Es ist Liù, die Dienerin seines Vaters. Die russische Sopranistin Kristina Mkhitaryan gibt diese feinfühlige, liebende Figur sehr eindrucksvoll und gesanglich brillant. Liù opfert sich, prophezeit Turandot aber zuvor, dass auch sie einmal lieben wird und nimmt sich das Leben.
An dieser Stelle endet Puccinis Komposition, er verstirbt an Krebs, hinterließ jedoch zahlreiche Skizzenblätter für den letzten Akt. Der Verlag beauftragte Franco Alfano mit der Fertigstellung, und die Ereignisse rund um die Varianten sind höchst spannend – Meister Toscanini spielte dabei eine große Rolle. Jedenfalls entschied sich Claus Guth für die ursprüngliche, ungekürzte "Alfano 1", weil dabei die Wandlung und Liebesgeschichte der beiden Hauptpersonen schlüssig herausgearbeitet wird.
Zum großartigen Opernerlebnis gehört auch der klanggewaltige Chor, der zu Beginn abstrakt vor der Spielfläche platziert wird, in den intimeren Szenen nicht sicht- aber hörbar bleibt, um dann in den uniformen hellgrünen Anzügen ein adäquates Schluss- und imposantes Hörbild abzugeben. Puccini versuchte, die Schauplätze seiner Opern durch Musik zu erschaffen, da braucht es in der Inszenierung nicht mehr viel chinesisches Beiwerk. Und Turandot weiß am Ende den Namen, sie sagt „Liebe“!
Turandot von Giacomo Puccini
Oper in drei Akten
Text Renato Simoni und Giuseppe Adami nach Carlo Gozzi
Musikalische Leitung: Axel Kober
Inszenierung: Claus Guth
Bühne: Etienne Pluss
Kostüme: Ursula Kudrna
Choreographie: Sommer Ulrickson
Dramaturgie: Konrad Kuhn, Nikolaus Stenitzer
Turandot: Asmik Grigorian
Altoum: Jörg Schneider
Timur: Dan Paul Dumitrescu
Calaf: Ivan Gyngazov
Liù: Kristina Mkhitaryan
Mandarin: Attila Mokus
Ping: Martin Hässler
Pang: Norbert Ernst
Pong: Hiroshi Amako
Orchester und Chor der Wiener Staatsoper