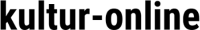Schon im Alter von 37 Jahren endete 1942 Greta Garbos Filmkarriere, doch ähnlich wie bei James Dean strahlt ihr Ruhm wohl gerade dadurch weit über ihren Tod im Jahre 1990 hinaus. Ihr Weg führte von Schweden über Deutschland nach Hollywood, wo sie mit tragischen Frauenrollen Karriere machte. Der Spielboden Dornbirn zeigt vier Stummfilme mit "der Göttlichen" mit Live-Musik-Begleitung.
Den Künstlernamen "Garbo" erfand erst 1924 ihr Mentor Mauritz Stiller. Ungeklärt ist dessen Herkunft, könnte auf das schwedische Wort für "Kobold" ebenso verweisen wie auf das spanische für "Anmut". Wichtig war nur, dass er in jeder Sprache leicht aussprechbar ist, elegant und international klingt.
Von ihrer Herkunft aus einfachen Verhältnissen löste sich die am 18. September 1905 in Stockholm geborene Greta Lovisa Gustafsson damit. Die Schauspielerkarriere war ihr nicht in die Wiege gelegt, sondern sie musste nach dem Tod ihres Vaters schon als 14-Jährige, um die Familie zu unterstützen, als Einseifmädchen bei einem Friseur arbeiten. Mit Aufträgen als Model für den Katalog eines Stockholmer Kaufhauses besserte sie ihr Einkommen auf und beschloss nach zwei Auftritten in kurzen Werbefilmen Schauspielerin zu werden.
Nach der Aufnahme in die Schauspielakademie des Königlichen Dramatischen Theaters in Stockholm spielte sie in der Slapstickkomödie "Luffar-Petter" (Erik A. Petschler, 1922), doch entscheidend für ihre Karriere war die Entdeckung durch Mauritz Stiller, der nicht nur Direktor des Theaters, sondern auch Filmregisseur war.
Stiller gab ihr eine Nebenrolle in der Lagerlöf-Verfilmung "Gösta Berlings Saga" (1924), doch weitere gemeinsame Filmpläne zerschlugen sich. Dafür spielte die Garbo in Georg Wilhelm Pabsts "Die freudlose Gasse" (1925) an der Seite der legendären Asta Nielsen ein armes Mädchen, das die pure Not in die Prostitution treibt: Still leiden und geduldig alles ertragen wird bis in die Tonfilmzeit eine Rolle bleiben, die sie immer wieder variieren wird.
Im selben Jahr begleitete sie Stiller nach Hollywood, der einen Vertrag bei der neu gegründeten MGM erhielt. Beim Treffen mit Studioboss Louis B. Meyer war dieser von der Schwedin so beeindruckt, dass er ihr einen Dreijahresvertrag gab. Schon für ihre Darstellung in ihren ersten beiden US-Filmen "Torrent" ("Fluten der Leidenschaft"; Regie: Monta Bell, 1926) und "The Temptress" ("Dämon Weib"; Regie: Fred Niblo, 1926), in denen sie lebenslustige Sudamerikanerinnen spielte, wurde sie hoch gelobt, doch der Durchbruch gelang ihr 1927 mit dem Film "Flesh and the Devil" ("Es war"; Regie: Clarence Brown).
Wie bei ihren ersten beiden US-Filmen und mit Ausnahme von "The Divine Woman" ("Das göttliche Weib"; Reige: Victor Sjöström, 1928) und "The Single Standard" ("Unsichtbare Fesseln"; Regie: John S. Robertson, 1929) stand bei „Flesh and the Devil“ und allen folgenden Filmen bis 1939 William Daniels hinter der Kamera. Mehr als ihre Regisseure prägte Daniels den Stil der Garbo-Filme und trug wesentlich zum "Mythos Garbo" bei.
Daniels fügte immer wieder Nahaufnahmen ein, um das sorgfältig ausgeleuchtete Gesicht des Stars wie ein Gemälde zu präsentieren. Nicht mehr um eine Geschichte erzählt zu bekommen, sondern vor allem um Großaufnahmen der Garbo zu sehen, gingen bald viele Zuschauer ins Kino.
Der Erfolg von "Flesh and the Devil" stärkte ihre Position: Durch Streik erreichte sie, dass ihre Gage von 500 Dollar pro Woche auf 5000 erhöht wurde, und sie setzte bei den MGM-Bossen Louis B. Mayer und Irving Thalberg durch, dass sie ihre Rollen zumindest teilweise selbst aussuchen konnte.
Dennoch waren die Drehbücher ihrer Stummfilme recht stereotyp, meist kreisten sie um eine junge Frau, die romantische Verwicklungen zwischen einem leidenschaftlichen Liebhaber und dem meist älteren Ehemann bestehen muss. Beim Publikum waren diese Filme dennoch - oder vielleicht auch gerade trotzdem - erfolgreich.
Im Gegensatz zu anderen europäischen Stars gelang Garbo mit ihrer dunklen, klaren Stimme auch problemlos der Sprung zum Tonfilm. Mit "Garbo talks" wurde die Eugene O´Neill-Verfilmung "Anna Christie" (Clarence Brown, 1930) angekündigt. Markant war schon ihr Auftrittsatz, zumal in der parallel gedrehten deutschen Version: "Whiskey, aber nicht zu knapp."
Für die Verkörperung der verbitterten alkoholkranken schwedischstämmigen Ttelfigur wurde sie zum ersten Mal für den Oscar nominiert, verlor aber gegen Norma Shearer. Zwei weitere Nominierungen folgten 1938 für "Camille" ("Die Kameliendame"; George Cukor, 1936) und 1940 für "Ninotchka" (Ernst Lubitsch, 1939), doch auch hier zog sie den Kürzeren, erhielt aber 1955 einen Ehrenoscar "für ihre unvergesslichen Filmdarstellungen".
Ganz auf den weiblichen Superstar setzte man bei der Spionagegeschichte "Mata Hari" (George Fitzmaurice, 1931), deren Handlung in erster Linie Vorwand ist, um die Garbo in spektakulären Kostümen vom durchsichtigen Negligé bis zum Hosenanzug und mit extravaganten Hüten zu präsentieren. 30.000 Dollar gab MGM für die Kostüme aus, die Garbo in diesem Film trug. Sie selbst interessierte sich zwar nicht für Mode, beeinflusste diese aber und schuf auch mit ihren Frisuren und Hüten Trends.
Spielte sie in der Stummfilmzeit verführerische junge Frauen, so wurde sie im Tonfilm vor allem in tragischen Rollen besetzt. Obwohl nur 27 Jahre alt, spielte sie in der Vicky Baum-Verfilmung "Grand Hotel" ("Menschen im Hotel"; Edmund Goulding, 1932) eine alternde Ballerina, die den legendären Satz "I want to be alone" sprechen darf, und Rouben Mamoulian ließ seinen Film über Königin Christine von Schweden ("Queen Christina", 1933), die Thron und Liebhaber verliert, mit einer leinwandfüllenden Aufnahme von Garbos unbewegtem Gesicht enden.
Unter der Regie von George Cukor spielte sie die unglücklich liebende "Camille" ("Die Kameliendame", 1936) und unter Clarence Brown, mit dem sie insgesamt sieben Filme drehte, "Anna Karenina" (1935), die sie schon in der Stummfilmzeit einmal gespielt hatte, und in "Conquest" ("Maria Walewska", 1937) die Geliebte Napoleons.
Da diese tragischen Frauenfiguren beim Publikum aber zunehmend weniger ankamen, beschloss das Studio Garbo in einer Komödie einzusetzen. Analog zu "Garbo Talks" bei "Anna Christie" wurde Ernst Lubitschs "Ninotchka" (1939) mit "Garbo Laughs" angekündigt. Als Idealbesetzung einer stocksteifen sowjetischen Kommissarin, die in Paris ihre dem Reiz des süßen Lebens erlegenen Genossen zur Raison rufen soll, erwies sich die kühle Schwedin hier und souverän spielt auch Lubitsch mit ihrem Image.
An diesen Erfolg sollte mit George Cukors "Two-Faced Woman" ("Die Frau mit den zwei Gesichtern", 1941), in dem die Garbo erstmals eine Doppelrolle spielte, angeknüpft werden, doch fiel diese Komödie, die denkbar ungünstig unmittelbar nach dem Angriff auf Pearl Harbour in den Kinos anlief, bei Kritik und Publikum völlig durch.
37 Jahre war der Star erst alt und hatte keineswegs die Absicht sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen, doch alle weiteren Projekte scheiterten. Die Rolle der Blanche Dubois in "A Streetcar Named Desire", für die sie Tennessee Williams gewinnen wollte, lehnte sie ebenso ab, wie Ingmar Bergmans Anfragen bei "Das Schweigen" (1963) und "Herbstsonate" (1978). David O. Selznicks Angebot einer Hauptrolle in "The Paradine Case" (Alfred Hitchcock, 1947) und in "I Remember Mama" ("Geheimnis der Mutter"; George Stevens, 1948) schlug sie mit den Worten "Keine Mamas, keine Mörderinnen" aus und ein Projekt, das Max Ophüls 1950 in Italien und der Bundesrepublik Deutschland drehen wollte, kam aufgrund der Skepsis der Produzenten nicht zustande.
Immer mehr zog sich die Garbo, die während ihrer gesamten Laufbahn nur insgesamt 14 gesicherte Interviews gab, so von der Öffentlichkeit zurück und schlug beispielsweise auch eine Einladung von Königin Elisabeth II. mit der Begründung "Ich habe nichts zum Anziehen" ab.
Zahlreiche Schauspielerinnen wollte man zu einer zweiten Garbo aufbauen, doch einzig Marlene Dietrich konnte ähnliche Berühmtheit erlangen. Mit ihr verbindet Garbo, die nie geheiratet hat, auch das zurückgezogene Leben im Alter. Bis zu ihrem Tod am 15. April 1990 lebte sie abwechselnd in ihrer New Yorker Wohnung sowie in Klosters in der Schweiz und soll am Ende ihres Lebens die fehlende Bindung an einen Menschen als das größte Manko ihres Lebens bezeichnet haben.
Ausschnitt aus "Ninotchka"